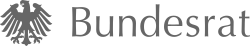Back Bundesrat (Deutschland) ALS البوندسرات Arabic Bundesrat Azerbaijani Бундэсрат Германіі Byelorussian Бундэсрат BE-X-OLD Бундесрат (Германия) Bulgarian Bundesrat Breton Bundesrat (Alemanya) Catalan بووندێسراتی ئەڵمانیا CKB Spolková rada (Německo) Czech
| Bundesrat — BR — | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Sitz: | Bundesratsgebäude, |
| Legislaturperiode: | Ständiges Organ ohne Legislaturperioden |
| Erste Sitzung: | 7. September 1949 |
| Abgeordnete: | 69 |
| Aktuelle Legislaturperiode | |
| Vorsitz: | Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger, SPD Erste Vizepräsidentin Manuela Schwesig, SPD Zweiter Vizepräsident Andreas Bovenschulte, SPD |

| |
| Website | |
| www.bundesrat.de | |
| Bundesratsgebäude in Berlin | |
 | |
Der Bundesrat (Abkürzung BR)[1] ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Jedes Land ist durch Mitglieder seiner Landesregierung im Bundesrat vertreten, nach Bevölkerung zwischen 3 und 6 Personen, insgesamt 69 Personen. Es ist keine zweite Kammer des Parlaments, die gleichberechtigt über Gesetze entscheidet, wie z. B. in den USA oder der Schweiz. Nach Art. 50 GG gibt es Gesetze, denen der Bundesrat zustimmen muss, bei anderen darf er Einspruch erheben, der Bundestag kann jedoch überstimmen. Verordnungen der Regierung, die Bundesländer betreffen, darf er zustimmen oder ablehnen. EU-Institutionen darf der Bundesrat direkt kontaktieren, bei EU-Entscheidungen darf der Bundesrat mitwirken, der Artikel im Grundgesetz legt das jedoch nicht fest, Details sind im EUZBLG und im IntVG geregelt. Der Bundesrat kann Mitglieder der Bundesregierung befragen und Anhörungen verlangen.
Trotz der vielen Einschränkungen ist der Bundesrat ein Ausdruck des Föderalismus und führt eine deutsche Verfassungstradition aus der Kaiser- und Fürstenzeit bzw. dem Deutschen Reich fort. Staatsrechtlich lässt sich der Bundesrat weder der Gesetzgebung, noch der Verwaltung zuordnen, ist in beidem eingebunden und daher ein Organ sui generis. Die Mitglieder sind weisungsgebunden, nicht gewählt, sondern werden von den Ländern üblicherweise nach Regierungswechsel entsendet.
Nur selten haben die Parteien, die im Bundestag eine Koalition bilden und die Bundesregierung stellen, gemeinsam auch eine Mehrheit im Bundesrat. So müssen weitere Parteien für zustimmungspflichtige Gesetze gewonnen werden. In den ersten Jahrzehnten nach Gründung der Bundesrepublik stieg der Anteil dieser Gesetze, die der Zustimmung des Bundesrates bedurften, stark an und damit die Bedeutung einer Mehrheit im Bundesrat. Im Jahr 2006 und danach versuchte man in sogenannten Föderalismus-Reformen, die Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze zurückzudrängen, was aber nicht im erhofften Ausmaß eingetreten ist.[2][3] Die Kompromissfähigkeit ist im Allgemeinen sehr hoch, sodass nur wenige Gesetze endgültig abgelehnt werden (Vermittlungsausschuss).[2]
- ↑ Abkürzungsverzeichnis. (PDF; 49 kB) Abkürzungen für die Verfassungsorgane, die obersten Bundesbehörden und die obersten Gerichtshöfe des Bundes. In: bund.de. Bundesverwaltungsamt (BVA), archiviert vom am 28. März 2020; abgerufen am 23. Mai 2017.
- ↑ a b Dietrich Thränhardt: Gesetzgebung. In: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. 7. Aufl. Heidelberg 2013. Andersen, Uwe / Wichard Woyke, abgerufen am 4. Juli 2021.
- ↑ Statistik. In: Website Bundesrat. Bundesrat, abgerufen am 4. Juli 2021.